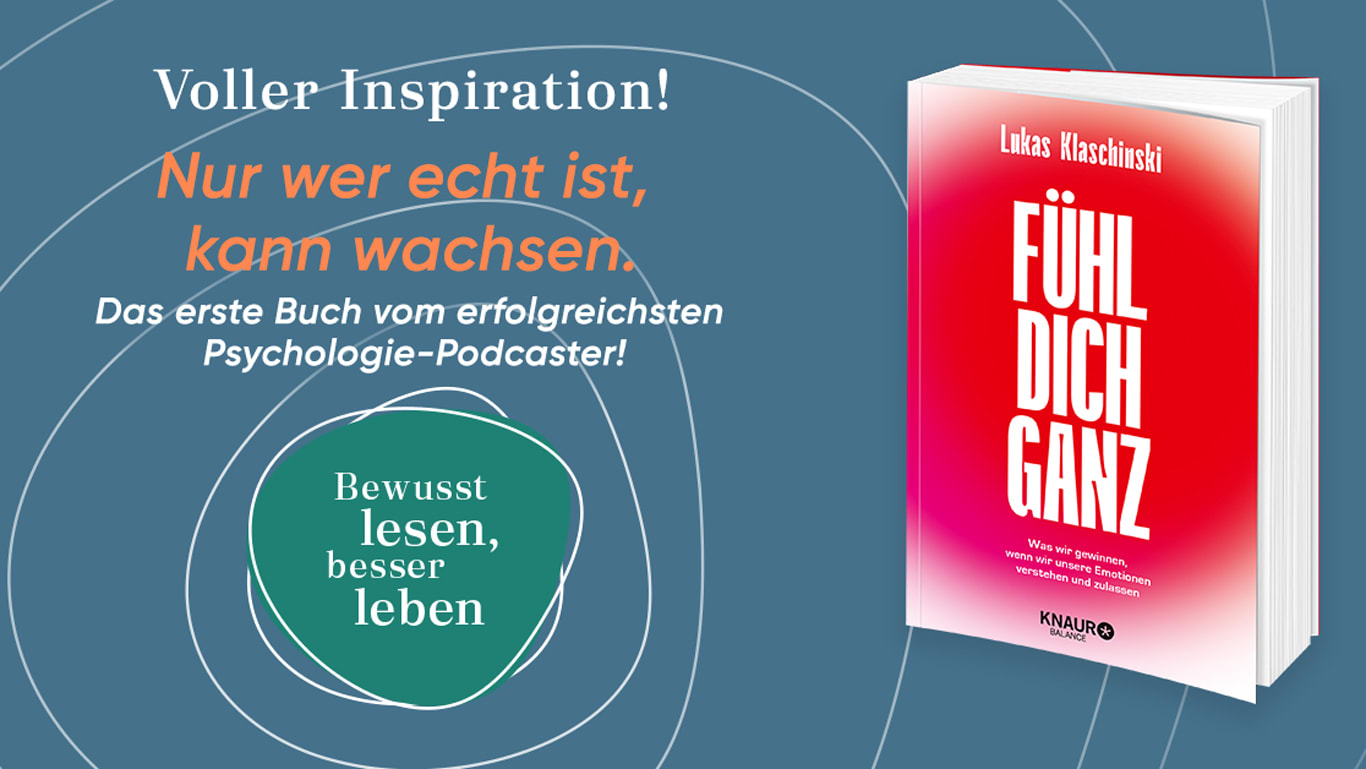Gefühle: welche es gibt und wie sie entstehen
Wie du Gefühle von Emotionen und Gedanken unterscheidest und dein authentisches Selbst entdeckst
»Wie fühlst du dich?« Auf diese Frage antworten wir häufig automatisiert mit Adjektiven wie »gut«, »gestresst«, »müde« oder gar »normal«. In den seltensten Fällen haben diese Antworten etwas mit unseren wahren Gefühlen zu tun.
Das liegt einerseits daran, dass wir unsere Gefühle häufig aus unterschiedlichen Gründen verdrängen und nicht mit ihnen verbunden sind. Andererseits wissen wir oft gar nicht, was mit dem Begriff »Gefühl« überhaupt gemeint ist.
Dabei bestimmen unsere Gefühle maßgeblich, wie wir unser Leben gestalten. Von unseren Gefühlen hängt ab, mit wem und auf welche Weise wir Beziehungen führen und welches Selbstbild wir haben. Wenn wir unsere Gefühle nicht wahrnehmen und/oder negative Gefühle bewusst vermeiden, sind wir gewissermaßen auf Autopilot – so formuliert es auch Lukas Klaschinski in seinem Buch »Fühl dich ganz«. Denn die Gefühle sind da und bestimmen unser Handeln, ob wir mit ihnen in Kontakt sind oder nicht. Kümmerst du dich um deine Gefühle, übernimmst du also bewusst das Ruder auf dem Weg in ein freieres Leben. Aber was sind Gefühle eigentlich?
Was sind Gefühle und welche Gefühle gibt es?
Gefühle machen einen großen Teil unseres menschlichen Erlebens aus. Wir können uns (mal leichter, mal nur nach großer Überwindung) über unsere Gefühle austauschen. So haben zwei Menschen, die sich ihre Liebe gestehen, eine bestimmte Vorstellung, was mit Liebe gemeint ist. Trotzdem ist jedes Gefühl eine höchst individuelle Empfindung, die nie vollständig der eines anderen Menschen in dieser Situation entspricht.
Als Reaktionen auf Reize aus unserer Umwelt helfen Gefühle uns, Situationen aus unserer persönlichen Perspektive heraus zu bewerten, auch wenn wir uns dieses Vorgangs nicht (immer) bewusst sind. Dieses Bewertungssystem ist zum einen evolutionsbedingt. Der Anblick eines gefährlichen Raubtiers in freier Wildbahn löst Angst in uns aus, was zu einer Fluchtreaktion führt und so unser Überleben sichert. Zum anderen wird dieses System aber auch durch jede einzelne unserer täglichen Erfahrungen geformt und erweitert und entwickelt sich so zu unserem ganz persönlichen Kompass im Leben.
Obwohl die subjektiven Empfindungen bei Gefühlen variieren, lassen sie sich in übergeordnete Kategorien einteilen. Je nach Modell gibt es sieben bis zehn Basisemotionen, aus denen sich komplexere Emotionen zusammensetzen. Das sind beispielsweise die primären Emotionen nach dem Psychologen Robert Plutchik:
- Freude
- Traurigkeit
- Wut
- Angst
- Vertrauen
- Ekel
- Überraschung
- Vorfreude
Aus Kombinationen dieser Grundemotionen können sich laut Plutchik viele weitere komplexere (oder auch sekundäre) Gefühle ergeben. So z. B.:
- Freude + Vertrauen = Liebe
- Wut + Angst = Aggressivität
- Traurigkeit + Überraschung = Enttäuschung
Eine andere Möglichkeit, Gefühle zu kategorisieren, ist das Modell der Gefühlsfamilien nach der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM).
Wie unterscheiden sich Gefühle und Emotionen?
Die Begriffe »Gefühl« und »Emotion« werden umgangssprachlich meist synonym gebraucht. Aus wissenschaftlicher Sicht ist das nicht ganz richtig. Um zu erklären, wie beide zusammenhängen bzw. sich unterscheiden, gibt es je nach Fachrichtung verschiedene Modelle. Einigkeit herrscht aber darüber, dass Emotionen evolutionsbedingte Reaktionen auf bestimmte Reize sind, die unser Überleben sichern sollen, während Gefühle unser individuelles inneres Erleben der jeweiligen Emotion beschreiben.
Deshalb können Emotionen auch sichtbar werden durch automatisierte körperliche Reaktionen, wie beispielsweise Schwitzen oder eine schnellere Atmung als Antwort auf Gefahr, wohingegen das Gefühl der Angst ganz unterschiedlich empfunden und kognitiv bewertet werden kann.
Unsere Mitmenschen können also unmöglich wissen, wie wir uns fühlen. Sie können aber mitunter anhand unserer körperlichen Reaktionen erkennen, welche Emotion wir durchleben, weil unsere individuellen Gefühle Teile der Emotionen sind, die allen Menschen durch die Evolution gleichermaßen genetisch eingeschrieben sind.
Wie entstehen Gefühle?
Für die Entstehung unserer Gefühle ist vor allem der präfrontale Kortex zuständig. In diesem Teil des Gehirns, der beim Menschen im Verhältnis deutlich ausgeprägter ist als bei (anderen) Tieren, werden die Emotionen als unbewusste Reaktionen auf Reize aus der Umwelt reflektiert und so auf die Ebene des individuellen Selbstbewusstseins gehoben. Dort entscheidet sich also, wie wir persönlich die Emotion empfinden.
Dieser Schritt vom Automatismus zum Bewusstsein ist extrem wichtig. Denn könnten wir unsere Emotionen nicht über unser Bewusstsein regulieren, würden wir beim Anblick des Mörders im Krimi dasselbe empfinden wie bei einem tatsächlichen Angriff auf unser Leben, und unsere Abwehrreaktionen fielen entsprechend heftig aus.
Durch die Verarbeitung unserer Gefühle im präfrontalen Kortex haben wir also die Wahl, wie wir auf bestimmte Reize reagieren wollen, und müssen uns nicht von unseren Emotionen überrollen lassen.
Warum sollten wir negative Gefühle nicht unterdrücken?
Die meisten von uns haben von klein auf gelernt, unsere Gefühle zu kontrollieren, zu unterdrücken und gerade heftige Gefühle wie Wut nicht zu zeigen, um andere nicht vor den Kopf zu stoßen. Ein besonderer Druck liegt dabei häufig immer noch auf jungen Mädchen, die in patriarchalen Strukturen zum »Gefallen« erzogen werden. Wer seinen Gefühlen freien Lauf lässt, wirkt auf andere schnell impulsiv und irrational und weniger »umgänglich«.
Dabei wird übersehen, dass hinter jedem Gefühl ein Bedürfnis steht, das befriedigt werden möchte. Unterdrücken wir unsere Gefühle, wissen wir nicht, was wir gerade wirklich brauchen. Und kommunizieren wir unsere Gefühle nicht gegenüber unseren Mitmenschen, wissen diese nicht, was uns in der Beziehung zu ihnen wichtig ist.
Es fehlt an Orientierung und Tiefe. Geben wir unseren Gefühlen mehr Raum in unserem Leben, verbessert das also nicht nur unser Verhältnis zu uns selbst – unser Selbstbewusstsein, sondern auch unsere Beziehungen.
Gefühl vs. Gefühlsgedanke
Gesellschaftlich wird der Verstand vom Gefühl getrennt und als diesem übergeordnet betrachtet. Gefühlen wird keine Priorität entgegengebracht, wenn es um wichtige Entscheidungen geht.
Wir wissen aber bereits, dass unser Verstand bei der Verarbeitung von Gefühlen sehr wohl eine Rolle spielt. Unser »Bauchgefühl«, unsere Intuition, entsteht aus der Summe unserer Erfahrungen und kann daher ein wichtiger Ratgeber bei all unseren Entscheidungen sein.
Damit unser Bauchgefühl verlässlich ist, brauchen wir aber ein gutes Körpergefühl. Denn oft verwechseln wir Gefühle mit Gedanken. Wenn jemand dir z. B. einen Gefallen tut, ist es wahrscheinlich, dass du dich dankbar zeigst. Das heißt aber noch lange nicht, dass du auch wirklich Dankbarkeit empfindest – vielmehr erfordert es die gesellschaftliche Situation, dass du dankbar bist.
Gefühle gehen aber immer mit einer körperlichen Empfindung einher. Spürst du das Gefühl nicht in deinem Körper, handelt es sich demnach um einen Gefühlsgedanken und nicht um ein »echtes« Gefühl. Zwischen beiden unterscheiden zu können, stärkt deine Intuition und macht sie zu einem zuverlässigen Orientierungspunkt, auch in schwierigen Entscheidungssituationen.
Übung: Gefühle von Gedanken unterscheiden lernen
Wenn du dir unsicher bist, was Gefühle und was Gedanken sind, kann dir diese Übung dabei helfen, echte Gefühle im jeweiligen Moment in deinem Körper zu spüren: als Kribbeln, als Wärme, als Grummeln oder Knoten. Aus dieser Erkenntnis können wir eine Übung kreieren, bei der du ins Spüren kommst und deine emotionale Intelligenz schulst.
- Schließe für einen Moment die Augen und nimm ein paar tiefe Atemzüge.
- Richte deine Aufmerksamkeit auf das Gefühl bzw. den Gedanken, das oder den du erforschen möchtest.
- Nun spüre ganz bewusst in deinen Körper hinein. Gibt es einen Ort, an dem sich dein Gefühl bzw. dein Gedanke manifestiert? Bemerkst du Verspannungen? Empfindest du Körperregionen als eng oder vielleicht auch besonders warm? Kribbelt es irgendwo?
- Verweile einen Moment bei dieser Empfindung und reflektiere, ob diese wirklich mit deinem fokussierten Gefühl bzw. Gedanken in Verbindung steht. Hinter dem Gedanken, dankbar sein zu müssen, kann nämlich z. B. auch die Angst vor Ablehnung stehen.
- Hast du die körperliche Empfindung als Ausdruck deines Gefühls identifiziert, übe dich in Akzeptanz. Sowohl die positiven als auch die negativen Gefühle wie Scham und Eifersucht weisen dich, jedes für sich, auf ein bestimmtes Bedürfnis hin.
- Gibt es keine Verbindung zwischen deinem Gedanken und einer körperlichen Reaktion, kannst du ihn als »bloßen« Gedanken annehmen und ziehen lassen, wenn er dir in deiner Situation nicht dient.
Fazit: Fühle dich in dein authentisches Selbst
Während Emotionen deine evolutionsbedingten Reaktionen auf äußere Reize sind, beschreiben Gefühle dein ganz individuelles inneres Erleben. Sie bestimmen, wie du mit deiner Umwelt interagierst und deshalb letztlich auch, wer du als Mensch bist.
Gefühle wahrzunehmen und zu verstehen, wie und warum sie entstehen und welche Rolle sie in deinem Leben spielen, kann dir Orientierung und Sicherheit geben und dir helfen, dein authentisches Selbst zu leben, dein Selbstbewusstsein und deine Beziehungen zu stärken. Bei der Beantwortung der Frage, was Gefühle sind, ist es auch wichtig, Gefühle von Gedanken zu unterscheiden und so deine Intuition besser deuten zu können. Öffnest du dich dem Fühlen in all seinen Facetten, öffnest du dich dem Leben in all seiner Fülle.